„Es hat noch nie so viel Mathematik um uns herum gegeben
wie heute.“ Ayham
Haj Hammadeh (6a) im Gespräch mit Frank
Förster, dem Leiter der Mathematischen Lernwerkstatt an der TU Braunschweig.
Die Mathematische Lernwerkstatt wurde im Jahr 2000 von Professor Friedhelm Käpnick, Dr. Mandy Fuchs und dem damaligen Rektor Rudolf Guder gegründet. 2005 übernahm Frank Förster zusammen mit Wolfgang Grohmann die Leitung. 2025 feierte dieses besondere Förderangebot für mathematisch interessierte Schüler:innen sein 25-jähriges Jubiläum.
Erstmal zu Ihnen, wie alt sind Sie?
Ich bin 63.
Welche Hobbys haben Sie?
Ich bin hauptsächlich noch Musiker und spiele in der
PAuli BÄnd. Wir treten regelmäßig auf, um die zehn Mal pro Jahr. Das ist
eigentlich mein Haupthobby, die Musik. Ich reise auch sehr gerne. Kurz vor
Semesterbeginn waren wir auf dem Balkan: Nordmazedonien, Kosovo, Albanien und
Montenegro. Nächstes Jahr fliegen wir nach Indien.
Und ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Wir
machen mindestens einmal im Jahr mit Freunden aus Cottbus eine Fahrradtour mit
Gepäck. Nicht mit E-Bikes, sondern mit Bio-Bikes. Da sind wir richtig am
Strampeln, eine ganze Woche, etwa 50 Kilometer am Tag. Letzten Sommer haben wir
die Oder abgefahren. Eigentlich wollten wir von Cottbus bis Stettin, aber dann
hat es leider so geregnet, dass wir zum ersten Mal seit Jahren die Tour
abgebrochen und die letzten Tage im Trockenen verbracht haben.
Das dritte Hobby habe ich beinahe vergessen. Ich bin
nämlich ehrenamtlich seit 30 Jahren bei Jugend forscht mit dabei, also im
Vorstand Niedersachsen mit zwei anderen. Da bin ich der Sponsorpoolverwalter.
Wenn Schülerinnen und Schüler Geld für ihre Projekte brauchen, dann können sie
sich bei mir melden.
Schon im Referendariat am Martino-Katharineum hatte ich
eine Gruppe betreut, die bei Jugend forscht mitgemacht hat. Ein Lehrer hat mich
zur Seite genommen und meinte, Herr Förster, Sie sehen doch so aus, als wären
Sie interessiert an solchen Sachen. Da habe ich gesagt, ja, bin ich, und gleich
mitgemacht. So war ich an der Uni dann jahrelang Juror bei Jugend forscht, erst
beim Regionalwettbewerb, später beim Landeswettbewerb.
Was haben Sie studiert?
Ich habe in Marburg und Freiburg Mathematik, Physik und
Pädagogik studiert und bin ausgebildeter Gymnasiallehrer. Ich habe aber auch
noch ein Diplom in Mathematik. Für das Referendariat bin ich damals nach
Braunschweig gekommen und dann hier hängen geblieben. Nach dem Referendariat
hatte mein Studienseminarleiter gefragt, ob ich nicht für ein paar Jahre an die
Universität zurück möchte. Daraus sind irgendwie 30 Jahre geworden.
Warum haben Sie es studiert?
Ich sage es mal so, ich wollte Physik studieren. Physik
war eigentlich mein Hauptfach in der Schule. Ich fand Physik toll und
Mathematik immer ziemlich langweilig, nicht schwierig, aber langweilig. Das hat
sich komplett geändert vom ersten Tag an der Universität. Als ich gemerkt habe,
was Mathematik tatsächlich ist, also nicht das, was man in der Schule machen
musste, sondern dass es eine ganz tolle Art ist, über Dinge zu denken und
Probleme, Rätsel zu lösen. So war plötzlich die Physik das Nebenfach.
Ich versuche deshalb in der Lernwerkstatt das, was mich
an der Mathematik so fasziniert, rüberzubringen und darüber hinaus mit meinen
Kolleg:innen hier in den normalen Unterricht reinzubringen.
Was macht man in der mathematischen Lernwerkstatt?
Als wir sie übernommen haben, gab es nur die Förderung
für die Klassen 3 und 4. Aber ich bin ja nun Gymnasiallehrer, hatte mit
Grundschule nicht so richtig was am Hut und habe gesagt, dann machen wir auf
jeden Fall auch etwas für die Klassen 5 und 6. Später kamen noch die 7 und 8
dazu.
Wir versuchen eine Win-Win-Situation daraus zu machen.
Auf der einen Seite bieten wir Förderung für Schülerinnen und Schüler an. Auf
der anderen Seite sind es normale Lehrveranstaltungen, damit die Studierenden
interessierte Kinder mitbekommen. Und mittwochnachmittags kriegen sie dann auch
Schülerinnen und Schüler mit, die ganz große Schwierigkeiten mit der Mathematik
haben. Wir haben also nicht nur die Begabungsförderung, sondern auch Kurse, wo
es um Kinder mit Rechenschwäche geht.
Und wenn die Studierenden beide Seminare mitmachen,
dann kriegen sie die ganze Bandbreite mit, die ihnen an der Schule unterkommen
kann. Also Kinder, die schon am ersten Tag problemlos im Tausenderraum rechnen
können, und Kinder, die kaum bis 10 zählen können. Die dann gemeinsam in einem
Unterricht zusammenzukriegen, das ist die Schwierigkeit. Eine Möglichkeit,
damit umzugehen, nennt man in der Mathematikdidaktik Natürliche
Differenzierung: Alle kriegen kriegen dieselbe Aufgabe, aber die Art und Weise,
wie die Aufgabe bearbeitet wird, kann sehr unterschiedlich sein.
In der Regel sind es anderthalb Stunden in der Lernwerkstatt,
wo zu einem bestimmten Thema gemeinsam gearbeitet wird. Meistens
Problemstellungen, nicht nur Rechenaufgaben, sondern Dinge, wo man ein bisschen
nachdenken kann.
Wem empfehlen Sie die mathematische Lernwerkstatt?
In der Grundschule haben wir Kinder, die richtig Schwierigkeiten
haben, das sind die einen. Die anderen sind alle mathematisch interessierten
Schülerinnen und Schüler, die sagen, ich möchte über das, was wir in der Schule
machen, hinaus etwas mitbekommen.
Wir bieten im September immer eine Schnupperstunde an,
wo die Kinder vorbeikommen und sich angucken können, was wir hier machen. Von
ungefähr 100 Kindern in der Schnupperstunde kommen in der Regel 80 Kinder zum
Aufgabenwettbewerb.
Ich sage jetzt etwas, was nicht so gerne gehört wird,
aber Braunschweig ist natürlich zu klein, um eine Gruppe mit 20 wirklich
hochbegabten Kindern zusammenzukriegen. Hochbegabung ist wirklich ein seltenes
Ding. Wir sind da im Bereich von einem Prozent eines Jahrgangs. Aber das ist nicht
schlimm, weil ich finde, dass alle, die Spaß daran haben, auch die Möglichkeit
haben sollten, mitzumachen.
Und häufig entwickeln sich die Kinder erst im Laufe der
Jahre. Es ist gar nicht so einfach, bei einem Drittklässler festzustellen, ob
wirklich eine Begabung vorliegt oder nicht. Es wäre völlig falsch zu sagen,
dieser Aufgabenwettbewerb zeigt uns das hundertprozentig. Wir kriegen das erst
im Laufe der Zeit mit.
Wir haben den Aufgabenwettbewerb so konzipiert, dass
wir herauskriegen, ob das Angebot zu dem Kind passt. Ist es zum Beispiel
bereit, sich längere Zeit mit einer Aufgabe zu beschäftigen? Da ist eine
Viertelstunde für eine Aufgabe, eine lange Zeit, vor allen Dingen, wenn man gar
nicht weiß, wie man damit umgehen soll.
Und die Kinder, die sich dann durchbeißen und Lust dazu
haben, die versuchen wir auszuwählen. Wir haben in der Regel nur vier oder fünf
Kinder, die nach der dritten Klasse aufhören. Das ist der Grund, weswegen bei
Klasse 4 nicht so viele reinkommen können. In der fünften, sechsten, siebten
Klasse ist dann das Interesse entscheidend. Da ist immer Platz, wenn jemand
noch Lust hat, mit dazuzukommen.
Warum wurde die mathematische Lernwerkstatt gegründet?
Das war und ist natürlich ein Forschungsprojekt. Das
ist die dritte Win-Win-Situation: die Förderung der Kinder, die Ausbildung der
Studierenden und für uns die Möglichkeit, im Bereich der mathematischen
Begabung und bei rechenschwachen Kindern, Forschung durchzuführen.
Vorletztes Jahr zum Beispiel haben wir eine
Untersuchung durchgeführt, wo es um die Motivation der Kinder ging. Wir haben
von Klasse 3 bis Klasse 8 alle Kinder, die mitmachen wollten, befragt, wo sie
Unterschiede zwischen der Lernwerkstatt und dem normalen Unterricht sehen und
was sie dazu bewegt, hier mitzumachen. Die Ergebnisse haben wir auf einer
Tagung in Saarbrücken dann vorgestellt.
Was bietet die mathematische Lernwerkstatt den
Schülern, was die Schule nicht bietet? Fehlen uns eigentlich Themen in der
Schule?
Der wesentliche Unterschied ist, dass ihr aussuchen
könnt, wie ihr an ein Thema rangeht, wie ihr die Aufgaben lösen wollt. Es geht
nicht darum, einen bestimmten Stoff zu lernen, sondern das, was man schon in
Mathematik kann, auf ein bestimmtes Thema anzuwenden und sich Sachen zu
überlegen.
Auch die Wahlfreiheit: Wie gehe ich vor? Will ich
alleine arbeiten? Arbeite ich mit einem Partner oder in einer Gruppe? Und ihr
habt immer die Studierenden als Ansprechpartner. Und dass man in einer Gruppe
zusammen ist, wo alle Lust darauf haben, was zu machen. Das ist in der Schule
manchmal auch der Fall, aber nicht immer.
Was bietet die TU Braunschweig sonst noch für die
Kinder an, die über den Lernstoff der Schule hinaus Interesse haben?
Sehr viel. Im Moment gibt es vier große
Lehr-Lernlabore, die auch finanziell unterstützt werden. Das ist die
mathematische Lernwerkstatt, das Agnes-Pockels-Labor, die Grüne Schule und das
BIOS im Helmholtz-Institut.
Darüber hinaus gibt und gab es viele weitere Projekte.
Es gibt zum Beispiel eine Gruppe, die selber Raketen baut und diese Raketen
dann auch starten lässt. Es gibt die Mathe-Lok von Professor Harald Löwe, wo
man einen Kurs in angewandter Mathematik und Robotik machen kann. Ab Klasse 10
gibt es dann in Mathematik auch ein Frühstudium. Im Prinzip gibt es an der TU
Braunschweig von Klasse 3 bis 13 eine durchgehende Förderung in Mathematik.
Warum ist Mathe in der Schule nicht so beliebt?
Man muss da ein bisschen aufpassen, denn was ich auf
gar keinen Fall möchte, ist, hier irgendeine Lehrer-Schelte zu machen. Die
Kolleginnen und Kollegen bemühen sich nicht nur, sondern machen auch einen
guten Job und unterrichten gut. Aber es gibt natürlich deutlichere Vorgaben,
was gemacht werden muss. Das Witzige ist ja, dass Mathematik auf der einen
Seite das beliebteste Fach und gleichzeitig das unbeliebteste ist. Entweder
liebe ich es oder ich hasse es. Dazwischen gibt es nicht so viel.
Woran liegt das? Es liegt vielleicht daran, dass
Mathematik häufig nur als Lernfach gesehen wird. Und Studierende, aber auch
Schülerinnen und Schüler, ziehen sich diesen Schuh viel zu schnell an. Es gibt
viele, die gar nicht so weit gehen, dass sie sagen, ich versuche das zu
verstehen, sondern ich will es einfach nur für die nächste Klassenarbeit
lernen. Diesen Stoff hat man dann spätestens bei der übernächsten Arbeit wieder
vergessen.
Das liegt daran, dass viele Schülerinnen und Schüler
ein echtes Motivationsproblem haben, weil sie sagen, das ist etwas, was ich
sowieso nicht brauche. Das werde ich später im Leben überhaupt nicht mehr
brauchen. Das ist auch nicht ganz verkehrt. Denn das, was man an Mathematik
können muss, um irgendwie durch das Leben zu kommen, ist gar nicht so viel.
Aber es hat noch nie so viel Mathematik um uns herum gegeben
wie heute. Man erkennt sie nur nicht. Das heißt, sie ist versteckt. Es gibt
kaum Bereiche, die heutzutage nicht mathematisch optimiert oder zumindest
mathematisch durchdacht sind.
Von den Routen, die ein Postbote läuft, bis hin zu der
Milchtüte, die du im Supermarkt kaufst. Die sieht nicht zufällig so aus,
sondern ist optimiert, damit man mit möglichst wenig Material möglichst viel
Milch reinkriegt. Diese ganzen Rentenmodelle sind hochgradig mathematische, die
man verstehen muss, wenn man mitreden möchte. Oder was ist überhaupt
Besteuerung? Was ist ein Grenzsteuersatz? Die Leute hören nur 30 % oder 40 %.
Aber dass das nur bedeutet, wenn ich über einen gewissen Sockel hinaus etwas
verdiene, erst dann muss ich dieses Geld mit 40% versteuern, und alles, was ich
davor verdient habe, erstmal nicht. Das verstehen die meisten Leute nicht. Da
wird an vielen Stellen über Dinge geredet, ohne dass sie richtig verstanden
wurden.
Ich denke, solche Dinge sollen und dürfen und müssen im
Mathematikunterricht auch vorkommen. Dass man das Gefühl hat, das ist etwas,
was ich tatsächlich brauche für mein Leben, um die Welt zu verstehen. Das fängt
bei ganz anderen Dingen an.
Wie Wahlen zum Beispiel. Verkehr und Ampeln, wie lange
muss man warten? Man glaubt es nicht, aber natürlich ist das ein Modell, was da
drüber läuft.
Man kann auf der einen Seite viel mehr zeigen, was
Mathematik in den Anwendungen bringt. Auf der anderen Seite traut man sich viel
zu selten, auch Dinge, die innerhalb der Mathematik spannend sind, Schülerinnen
und Schülern näher zu bringen.
Wenn man sich mit einem Problem erstmal beschäftigt,
dann fängt es irgendwann an, interessant zu werden. Dann fragt man nicht mehr,
wozu brauche ich das, sondern dann ist einfach das Problem so interessant, dass
man Lust hat, darüber nachzudenken. Beide Seiten der Mathematik müssen
gleichermaßen im Unterricht vorkommen.
Warum finden viele Leute Mathe sehr kompliziert?
Weil sie kompliziert ist. Ja, warum ist Mathematik so
kompliziert? Weil es einfach wirklich schwierige und komplexe Dinge gibt. Auch
Anwendungen sind manchmal nicht einfach. Aber man muss sich ja nicht jedes
schwierige Problem ganz genau anschauen, man kann immer so weit einsteigen,
dass man sagt, soweit habe ich das verstanden, aber da ist noch etwas, was mich
herausfordert, weiterzudenken.
Und: Ich habe Mathematik immer geliebt, weil man so
wenig auswendig lernen muss. Weil man sich viele Dinge, wenn man dreimal
darüber nachgedacht hat, sowieso gemerkt hat. Im Gegensatz zu einer Sprache. Da
muss ich einfach die Vokabeln können.
Welche wesentliche und entscheidende Rolle spielt die
Mathematik, sodass sie von der 1. Klasse bis zum Abitur und Schulunterricht
vorkommt?
Wenn wir über die Grundschule reden, dann geht es um
erstmal darum, einigermaßen sicher rechnen zu können. Dieses Rechnen können,
schnell Dinge überschlagen, auch unabhängig vom Taschenrechner und anderen
Dingen, halte ich nach wie vor für wichtig. Später Prozentrechnung, die muss
man einfach sicher können. Nicht aus der Pistole geschossen, aber dass man
zumindest die Möglichkeit hat, zu überlegen und nachzurechnen. Bis Klasse 7
haben wir dann das, was man klassisch Bürgerliches Rechnen nennt. Also das, was
man für das alltägliche Leben braucht.
Dann kommen wir zu einer mehr oder weniger spezifischen
Bildung, also Dinge, die die Gesellschaft für wichtig hält, und auf der anderen
Seite die Berufsvorbereitung. Wenn du später Ingenieur oder
Naturwissenschaftler werden möchtest, musst du einfach mit Funktionen zum
Beispiel umgehen können. Wenn du später Psychologie studieren möchtest, musst
du sehr viel in Statistik verstanden haben. Es ist auf der einen Seite die
Bildung und auf der anderen Seite die Berufsausbildung, die auf der Schule ab
Klasse 7 stattfindet und auch stattfinden soll.
Besteht das Ziel des Mathematikstudiums darin,
Mathematiker wie Gauß und Euler zu werden, oder geht das Ziel darüber hinaus?
Also über Gauß und Euler hinaus nicht. Das sind zwei
Lichtgestalten der Mathematik, wobei sie vom Menschlichen her völlig
unterschiedlich wohl gewesen sind. Euler war ein sehr den Menschen zugewandter
Mensch, der unglaublich darauf geachtet hat, dass das, was er entwickelt hat,
auch verstanden wurde. Er ist einer der Ersten gewesen, der ein Lehrbuch zu
Algebra im europäischen Raum geschrieben hat, und weil er nicht mehr gut sehen
konnte, hat er es damals einem ehemaligen Schneidergesellen diktiert und sich erst
zufrieden gegeben, wenn dieser die grundlegenden Ideen auch verstanden hatte.
Gauß war ein absolutes Genie, muss aber wohl schwierig gewesen sein als Mensch.
Das sind Leute, mit denen man sich nicht unbedingt vergleichen muss.
Also was bringt die Mathematik? Es ist vor allen Dingen
eine spezifische Art zu denken, die man da lernt. Vieles, was in der Logik, in
der Mathematik stattfindet, findet in anderen Wissenschaften auch statt. Man
kriegt eine sehr solide Grundausbildung, wenn man Mathematik studiert, also
reine Mathematik. Für Gymnasiallehramt ist es natürlich ein bisschen weniger,
in Grund-, Haupt- und Realschullehramt noch deutlich weniger. Das ist wirklich
sehr auf das zugeschnitten, was später in der Schule gebraucht wird.
Viele, die reine Mathematik studiert haben, machen
später gar keine Mathematik mehr. Sehr viele sind dann im mittleren Management,
wo sie dadurch, dass sie gelernt haben, sich innerhalb von kürzester Zeit in
Probleme rein zu denken, dieses abstrakte Denken anwenden können.
Fast alle haben Probleme mit dem Mathematikstudium am
Anfang. Es gibt eigentlich kaum jemanden, der sagt, ach, das ist toll, gebt mir
noch mehr. Aber man darf nicht zu früh aufgeben.
Ich weiß noch, als in der Anfängervorlesung die
Kurvendiskussion losging, das macht man in der Oberstufe mindestens ein halbes
Jahr. An der Universität hat das Ganze genau 45 Minuten gedauert, dann war das
Thema erledigt. Es ist ein ganz anderes Tempo. Mich hat das fasziniert, aber
bei vielen fehlt dann die Bereitschaft, sich durchzubeißen. Und das gehört
einfach irgendwie mit dazu.
Wie kann man Matheunterricht besser machen?
Wenn jemand für sein Fach brennt und glaubt, etwas
weitergeben zu wollen, dann passt das schon. Ansonsten gibt es natürlich
verschiedene Dinge, wo man gucken kann, ob sie zu einem selber passen. Das, was
ich vorhin gesagt habe, diese natürliche Differenzierung, damit kann man
sicherlich gut arbeiten.
Was den Mathematikunterricht sicherlich nicht besser
macht, ist diese Vereinzelung, dass jeder seine eigene Aufgabe bekommt, die er
dann alleine bearbeitet. Das Wichtigste ist, hinterher über die Sachen zu
reden.
Das kommt nicht von ungefähr. Es gibt einen berühmten
Pädagogen, John Dewey, der soll mal gesagt haben: „Nicht durch das Tun, sondern
durch das Nachdenken über das Tun lernen wir etwas.“ Es geht nicht darum, irgendwas
zu machen, sondern darum, dass hinterher möglichst alle zusammen noch mal
darüber nachdenken: Was haben wir da gemacht, was können wir daraus lernen, wo
können wir das später noch weiter nutzen? Nicht in der Bearbeitungsphase,
sondern hinterher in der Besprechungsphase, da findet wirklich Lernen statt.
Diese Phasen werden leider häufig im Unterricht
übersprungen. Am Ende sind oft nur noch zwei, drei Minuten Zeit, wo man sagt,
hat es euch gefallen, habt ihr da was gelernt, es wird aber nicht mehr über den
Inhalt gesprochen. Das ist etwas, was ich in der Praxisphase bei unseren
Studierenden immer wieder sehe. Diese Besprechungsphase, die kommt immer viel,
viel, viel zu kurz. Es würde den Unterricht besser machen, wenn man sich dafür
mehr Zeit nimmt.
Wie ist es, Lehrer zu unterrichten?
Schön, mache ich ja seit 30 Jahren. Ich komme mit denen
gut zurecht und mir macht es immer noch viel Spaß. Was ich schön finde, ist,
wenn ich in irgendein Lehrerzimmer reinkomme, dann finde ich immer mindestens
drei, vier ehemalige Studierende. Und ich denke, solange die auf mich zukommen
und mich begrüßen und sich auch freuen, hat man nicht alles falsch gemacht in
der Ausbildung.
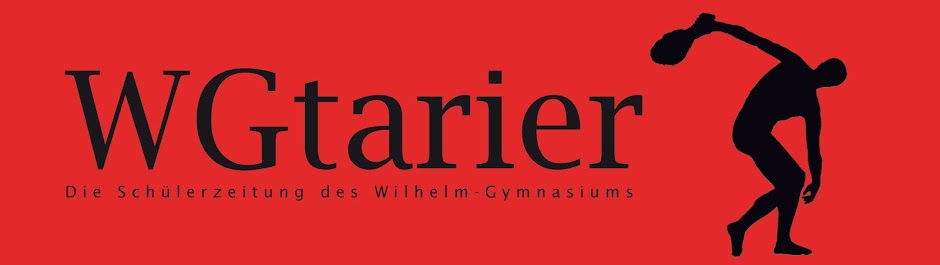





.jpg)














